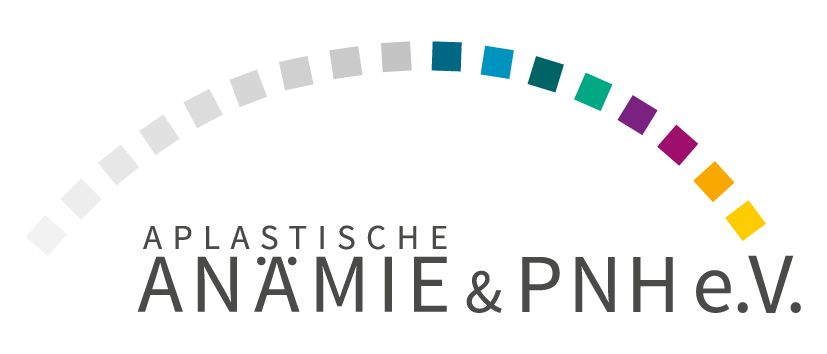Erfahrungsbericht von Susanne Schwertle
Beginn der Aplastischen Anämie
Ich hatte gerade mein erstes Semester des Studiums hinter mir und lebte seit einem halben Jahr mit meinem Sohn in meiner ersten eigenen Wohnung. Zuerst sind mir blaue Flecken aufgefallen, denen ich keine Beachtung schenkte. Als ich in der vorlesungsfreien Zeit im März 2016 nach Hause fuhr, hatte ich aber schon mal die Idee, zu meiner Hausärztin zu gehen. Ich war seit Jahren nicht mehr beim Arzt gewesen, das letzte Mal vor drei Jahren aufgrund der Schwangerschaft. Daraus wurde jedoch nichts mehr. In der Nacht bekam ich starkes Nasenbluten, das nicht mehr aufhören wollte. Erst gegen Mittag hat mich meine Mutter zur Hausärztin gefahren, die mich an einen HNO-Arzt überwies. Doch als sie wenig später mein Blutbild überprüfte, sagte sie, ich solle sofort in die Notaufnahme fahren. Meine Hausärztin tätigte einen Anruf in der Notaufnahme, um einige Informationen über meinen Zustand zu vermitteln.
Ich bin dann ins Krankenhaus gekommen. Der Verdacht auf eine akute Leukämie bestand. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass es sehr wichtig ist, die Aplastische Anämie recht schnell zu diagnostizieren. Ich hatte Glück, weil ich auf einen sehr kompetenten Arzt gestoßen bin. Innerhalb von drei Tagen schloss er die Leukämie aus und unterbreitete mir die Diagnose der Aplastischen Anämie. Leider kannte er sich mit der Krankheit nicht aus und überwies mich an die Uniklinik Greifswald.
Ich war erstmal erleichtert, keine Leukämie zu haben und nun zu wissen, woran ich bin… Ich las einiges über die Krankheit im Internet, was mir zu diesem Zeitpunkt nur mäßig weiterhalf.
Etwa eine Woche später war ich in der Uniklinik bestellt und der Arzt untersuchte mich, stellte mir Fragen und machte einen recht lockeren Eindruck. Ich bekam eine Woche später den nächsten Termin bei ihm. Dazu kam es jedoch nicht, weil ich wieder starkes Nasenbluten bekam und wieder in der Notaufnahme im Krankenhaus meiner Stadt landete. Dort sagte ich, dass ich Thrombozyten bräuchte, um die Blutung zu stoppen. Das interessierte niemanden. Darum kamen HNO-Ärzte, die mir die Nase verödeten und mit Tampons ausstopften. Niemand glaubte mir, dass diese Prozedur völlig unnütz war. Erst der Arzt, der die Krankheit diagnostiziert hatte, half mir und versorgte mich mit Thrombozyten. Danach wurde ich stationär in die Uniklinik Greifswald aufgenommen, wo mir viel über die Aplastische Anämie erzählt wurde. Daraufhin brach ich das Studium ab, kündigte die Wohnung und zog samt Sohn wieder zu Hause bei Mutti ein. Mein Leben außerhalb der Krankheit war erstmal auf Eis gelegt, für unbestimmte Zeit.
Für den Beginn der Krankheit ist es wichtig, an die richtigen Ärzte zu geraten, also an solche, die sich mit Aplastischer Anämie auskennen. So vermeidet man unnötige Eingriffe, wie das Veröden der Nase. Außerdem ist es ratsam, sich von Ärzten möglichst viele Informationen zu holen. Das betrifft z.B. Sport/Bewegungsverhalten, Ernährung, Umgang mit Haustieren usw. Dadurch vermeidet man Verletzungen mit inneren Blutungen und das Anstecken von Krankheiten, die vor dem Hintergrund der Aplastischen Anämie sehr gefährlich, ja sogar lebensgefährlich sein können.
Der Weg zur Therapie
Einige Monate, von März bis Juli, war ich Stammgast in der Ambulanz der Uniklinik Greifswald. Jede Woche holte ich mir Thrombozyten und Erythrozyten ab, wobei ich langsam ein Gefühl dafür entwickelte, wenn insbesondere Thrombozyten in meinem Blut knapp wurden. Nebenbei landete ich in dieser Zeit auch drei Mal im Krankenhaus, aufgrund eines schlechten Allgemeinzustandes. Einmal plagten mich dicke Beine und Übelkeit, ein anderes Mal hatte ich mir einen Virus eingefangen. Nach einer Woche war ich aber immer wieder draußen. Nun wusste ich ja, an wen ich mich wenden musste und konnte. Alles, was andere Ärzte mit mir machen wollten, besprach ich erst mit den Spezialisten. So lehnte ich z.B. eine Magenspiegelung ab, weil das Blutungsrisiko einfach zu hoch gewesen wäre.
Dann kamen die Ärzte auf mich zu, um eine Therapie zu besprechen. Mir wurde eine Knochenmarktransplantation nahe gelegt und die Suche nach einem Spender war bereits eingeleitet. Davon fühlte ich mich etwas überrumpelt. Mir war bekannt, dass es noch einen anderen Weg der Therapie gab, nämlich die Behandlung mit Immunsuppressiva. Per Telefon und Mail habe ich mir eine Zweitmeinung eines Spezialisten für Aplastische Anämie aus Süddeutschland geholt. Der sagte, wäre ich seine Patientin, hätte er mich längst mit Immunsuppressiva behandelt. Da war ich etwas verwirrt, weil mir irgendwie jeder etwas anderes geraten hat. Meine Überlegung war, dass ich Angst vor der Chemo hatte, die bei einer Knochenmarktransplantation nötig war. Ich hatte auch Angst, dabei zu sterben. Auf der anderen Seite wollte ich wieder komplett gesund werden, möglichst schnell von Blutkonserven loskommen und nicht ewig Tabletten schlucken müssen. All das wäre bei der Therapie mit Immunsuppressiva auf mich zugekommen.
Ich entschied mich also für die Knochenmarktransplantation. Ich war einen langen Weg der Entscheidungsfindung gegangen und war mir nun sicher…? Nein. Eine Aplastische Anämie ist kein Kinderspiel und der Weg der Genesung ein langer voller Risiken. Egal, für welche Variante man sich entscheidet.
Bei der Entscheidungsfindung sollte man sich möglichst von mehreren Ärzten beraten lassen, eben eine Zweitmeinung einholen. Man sollte aber auch auf sein Bauchgefühl hören und persönliche Aspekte berücksichtigen. Z.B. ist bei der Knochenmarktransplantation ein langer Krankenhausaufenthalt im Einzelzimmer notwendig. Je nach dem, was für ein Typ Mensch man ist, fällt einem dies leichter oder es kann eine erhebliche psychische Belastung darstellen. An dieser Stelle möchte ich den Menschen von Aplastische Anämie e.V. für die Unterstützung danken. Sie haben mir wirklich sehr geholfen, meine Entscheidung zu treffen, vielleicht noch mehr, als die Ärzte. Weiterhin bedanke ich mich für den Fachtag zur Aplastischen Anämie in Berlin, den meine Geschwister in meinem Namen besuchen konnten, kurz nachdem die Krankheit ausbrach.
Vorteil ist, dass ich für die Entscheidung genügend Zeit, also etwa 2 Monate Zeit hatte. Es war auch ganz gut, dass ich nicht vorher alles bis ins kleinste Detail wusste. Das große Ziel, gesund zu werden, stand im Vordergrund und da standen meine Chancen gar nicht schlecht. So ging ich recht mutig ins Krankenhaus zum “Finale”.
Die Therapie
Ich wurde vor der Chemotherapie nochmal gründlichst untersucht: Herz, Lunge, Knochenmark usw. Danach sollte ich 5 Tage lang eine ziemlich harte Chemotherapie bekommen, dann eine Ganzkörperbestrahlung und dann endlich die Knochenmarktransplantation. Daraus wurde dann überraschenderweise nichts. Die Pathologen hatten mein Knochenmark untersucht und hatten herausgefunden, dass gar keine Aplastische Anämie mehr vorlag. Zuerst dachte ich an eine Spontanheilung, die durchaus vorkommen soll. Wie unter Schock verließ ich also das Krankenhaus. Ebenso überrascht wie ich waren die Ärzte aus der Ambulanz. Mein Fall wurde auf der Tumorkonferenz erneut vorgestellt und es wurde beschlossen, dass die Krankheit doch vorlag und ich die Knochenmarktransplantation bekommen sollte.
Durch diese Verhandlungen blieb mir noch etwas Zeit. Ich verbrachte eine schöne Woche mit meiner Familie an der Ostsee und konnte mich von Bekannten und Freunden verabschieden, da sie mich ja nun länger nicht sehen würden.
Mit Büchern und Malzeug bewaffnet, trat ich den Krankenhausaufenthalt an. Ich war relativ gut drauf. Gleich am zweiten Tag fuhr ich zur Ganzkörperbestrahlung, die in einer anderen Klinik stattfand. So entkam ich zum vorläufig letzten Mal dem Krankenhaus. Danach begann auch schon die Chemotherapie. Davon merkte ich zuerst gar nichts, ich fühlte mich wohl. Irgendwann begann ich aber doch zu kotzen. Ich konnte nichts mehr essen, ohne es direkt danach wieder zu erbrechen. Meine Haare fielen aus. Nach 6 Wochen Krankenhaus war ich sehr entmutigt. Dazu muss gesagt werden, dass ich das Zimmer nicht verlassen durfte und die meiste Zeit am Schlauch hing. Zuerst war es die Chemo, die in mich hinein tropfte, dann die künstliche Ernährung und Antibiotikum. Abwechslung waren die Besuche der Psychologin, der Physiotherapeutin und meiner Mutter. Mein 3-jähriger Sohn durfte nicht mit auf Station, weil Kinder unter 14 Jahren die Station nicht betreten dürfen aufgrund von Gefahr von erhöhter Keimübertragung. Das klingt zwar traurig, aber ist vernünftig. Mein Kleiner hat nichts verpasst. Ich bin ganz froh, dass er mich nicht so gesehen hat. Dafür gibt es ja Telefon. Ich wusste, dass ich in der ersten Zeit, also als ich noch gesund war, immer für ihn da war, und hatte damit eine stabile Beziehung zu ihm, die durch 10 Wochen Trennung nicht kaputt gemacht werden konnte. Natürlich tat es mir leid, seine aktuellen Entwicklungsschritte nicht hautnah miterleben zu können.
Nach etwa 8 Wochen Krankenhausaufenthalt, in denen ich fast nicht das Zimmer verlassen hatte, hatte ich ein richtiges seelisches Tief. Ich fand alles blöd. Das Pflegepersonal kontrollierte alles, sogar meine Urinmenge. Jeden Morgen wurde ich um 7 Uhr aus dem Bett gerissen, um danach nichts zu tun. Ich fühlte mich ausgeliefert, sehnte mich nach meiner Familie und entwickelte arge Zweifel. Wäre die andere Therapie nicht doch besser gewesen? Macht das Leben überhaupt noch Sinn? Werde ich je wieder gesund? Ich war gleichgültig allem gegenüber, sprach wenig mit dem Pflegepersonal, hatte keine Konzentration mehr, mich mit Büchern und Malsachen zu beschäftigen. Die Ärzte legten mir nahe, trotzdem aufzustehen, mich hinzusetzen. Sonst wäre meine Muskulatur vollständig im Eimer gewesen.
Nach 10 Wochen Krankenhaus wurde ich entlassen, musste aber noch viele Tabletten schlucken. Übelkeit und Erbrechen waren immer noch ein Thema. Gleich wenige Tage nach der ersehnten Entlassung kam ich für vier Tage erneut ins Krankenhaus. Meine Nieren versagten. Wieder daheim, trank ich brav 2,5 Liter am Tag, aus Angst vor dem Krankenhaus. Bei der vorhandenen Übelkeit eine echte Herausforderung.
Die Zeit danach
Ich war drei Wochen auf Reha. Dabei verlor ich stark an Gewicht, ich wog noch 48 kg bei einer Größe von 1,69 m. Die Übelkeit war schlimmer geworden und ich konnte fast nichts mehr essen. Zudem hatte ich ein Ulkus an der Zunge, was schreckliche Schmerzen bereitete. Ich kam wieder ins Krankenhaus. Diesmal ging gar nichts. Ich konnte nicht lesen, hatte keine Lust zum Malen, sondern wollte einfach nur im Bett liegen. Den Rat der Ärzte, aus dem Bett aufzustehen, ignorierte ich völlig. Zwei Psychiater wurden zu mir geschickt und ich wurde intensiv von der Psychologin betreut. Das hat schon irgendwo geholfen, aber in den vier Wochen war ich richtig depressiv. Zudem übergab ich mich fast ständig und fühlte mich vom Personal unverstanden. Ich hatte den Gedanken, einfach einzuschlafen und nie mehr aufzuwachen. Ich verbrachte den Advent, Neujahr und meinen Geburtstag in der Klinik. Zu Weihnachten durfte ich auf eigene Verantwortung nach Hause fahren und verbrachte nur die Nächte im Krankenhaus.
Dieses Tief nahm ein recht plötzliches Ende. Die Übelkeit ließ nach. Das Ulkus an der Zunge tat weniger weh. Ich konnte wieder einigermaßen essen und trinken. Nach vier Wochen verließ ich das Krankenhaus nun endgültig und war glücklich.
Jetzt bin ich zu Hause. Alle paar Wochen habe ich einen Kontrolltermin in der Uniklinik Greifswald. Ich bin erstmal noch 6 Monate krankgeschrieben. Die Erwerbsminderungsrente und der Schwerbehindertenausweis sind beantragt. Meine Familie, also Mutter und Bruder, kaufen für mich ein, übernehmen einen Großteil der Hausarbeit und sorgen sich um mein Kind an den Stellen, wo ich es nicht kann. Ohne meine Familie hätte mein Kind ins Heim gemusst.
Es dauert wohl noch, bis meine Leukozyten wieder in normaler Anzahl im Blut auftreten und ich ohne Bedenken und Maske unter Menschen, insbesondere Menschenansammlungen, gehen kann. Ich habe mein Studium und meine Freunde verloren. Was mir die Zukunft bringt, weiß ich noch nicht. Ich bin dankbar, gesund zu sein und hoffe irgendwie auf das Beste. Damit ich diese Hoffnung behalte, habe ich mich freiwillig in therapeutische Behandlung gegeben. Etwa alle zwei Wochen spreche ich mit einem Psychotherapeuten. Besuch zu Hause zu empfangen, ist noch etwas schwierig. Meine Freunde vom Studium wohnen zu weit weg und die paar, die hier sind, haben Kinder oder sind zu beschäftigt. Von Besuch von Kindern hat der Arzt mir noch zwei Monate lang abgeraten. Der Psychotherapeut ist also die einzige Person, die nicht zu meiner Familie gehört und mit der ich ungestört reden kann.
Abschlussworte
Manchmal fühlt es sich eher wie ein Schock für mich an, wieder gesund zu sein bzw. es vollständig zu werden. Eigentlich will ich mich freuen, aber fühle mich doch in eine Depression abgleiten. Diese Unsicherheit “Was kann ich noch leisten?”, “Was bringt die Zukunft?” ist irgendwie immer da. Es gibt tausend Dinge, die ich in der Klinik vermisst habe und die ich jetzt gern tun möchte. Aber traue ich mich? Da ist nichts mehr so wie früher. Dem Tod irgendwie mal in die Augen geblickt zu haben, macht mich verletzlich und unsicher. Dabei weiß ich, dass andere Menschen viel schlimmere Krankheiten haben und dabei weniger von ihrer Familie unterstützt werden oder keine haben.
Ich denke oft an den Spender, den ich, wenn er es auch möchte, in sechs Monaten kontaktieren darf, um mich zu bedanken, auch im Namen meines Sohnes.
Dank der guten Aufklärung und Behandlung der Ärzte hatte ich stets das Gefühl, dass ich die Aplastische Anämie habe und nicht sie mich. Ich schwebte wohl auch nie in akuter Lebensgefahr, weil alles ohne größere Komplikationen verlaufen ist. In Ländern mit schlechterer medizinischer Versorgung wäre ich daran gestorben.
Ebenfalls denke ich in Dankbarkeit an das geduldige Pflegepersonal zurück. Viele Komponenten und die Hilfe vieler Menschen haben mir einen Weg aus der Krankheit in die Gesundheit verholfen.
Zur Chemotherapie kann ich sagen, dass sie den Körper einfach mal ein Stück weit kaputt macht. Ich sehe sie als notwendiges Übel, für das ich mich entschieden habe. So bin ich insgesamt recht schnell von den Blutkonserven losgekommen. Das ist insbesondere für die inneren Organe wichtig. Durch Blutkonserven nimmt der Körper automatisch zu viel Eisen auf, was sich in den Organen wie Leber, Herz und Nieren ablagert. Dagegen gibt es Medikamente, die das Eisen wieder ausleiten. Außerdem habe ich mir vor der Chemotherapie einen halben Eierstock entnehmen lassen, der nun tiefgefroren ist und auf mich wartet. Eine Chemotherapie kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und ich habe durchaus noch Kinderwunsch. Für mich gehört es zur vollständigen Genesung dazu, noch Kinder bekommen zu können.
Mir hat die Aplastische Anämie alles genommen. Meine Freunde, meinen „Fast-Partner“, mein Studium, zum Teil auch mein Kind. Ich denke, ich bringe den Mut nicht auf, ein zweites Mal völlig von vorn zu beginnen. An sich ist eine Aplastische Anämie kein Weltuntergang, wenn man einigermaßen seinen Platz im Leben gefunden hat. Ich war eben noch auf der Suche und meine Suche wurde von der Krankheit abgebrochen. Um ein zweites Mal BAföG zu bekommen, bin ich zu alt. Ich bin zwar so gesehen gesund, habe aber keine Perspektive mehr. Mir fehlen die Kraft und der Optimismus, nochmal Wohnung und Freunde in einer fremden Stadt zu finden.
Susanne Schwertle